Peter Knauer SJ
EIN ANDERER ABSOLUTHEITSANSPRUCH
OHNE EXKLUSIVE ODER INKLUSIVE INTOLERANZ
-
Gedruckt in:
Hermeneutics of Encounter
Essays in Honour of Gerhard Oberhammer on the Occasion of his
65th
Birthday (Publications of the De Nobili Research Library, Vol. XX).
Edited
by Francis X. D'Sa and Roque Mesquita, Vienna 1994, 153173. ISBN
3-900-
271-25-9.
ZUSAMMENFASSUNG:
In allen
Religionen
geht es um
Gemeinschaft mit Gott bzw. um ein letztes Geborgensein; darin
besteht
ihre grundlegende, unüberbietbare und unersetzbare Wahrheit. Um
mehr
kann es auch in der christlichen Botschaft nicht gehen. Aber sie
erläutert
von Jesus her Gemeinschaft mit Gott ausdrücklich auch angesichts
der
Tatsache, daß keine geschaffene Qualität Gemeinschaft mit
Gott
begründen kann: Gottes Beziehung zur Welt kann nicht an der Welt
ihr
Maß haben; sie ist im voraus dazu Beziehung Gottes auf Gott (der
»Heilige Geist« als die ewige Liebe des
»Vaters«
zum »Sohn«; weil dies nicht an der Welt ablesbar ist, wird
es erst durch Die Menschwerdung des »Sohnes« offenbar). Die
christliche Botschaft will nicht andere Religionen ersetzen, sondern
ihre
eigentliche Wahrheit unterstreichen. In der Bezeichnung der Schrift
Israels
als »Altes Testament« kommt ein neues und in christlicher
Sicht
endgültiges Verständnis dieses Textes im Licht der
Christusbotschaft
zum Ausdruck. Dieses Verhältnis des AT zum NT wird zum bleibenden
Paradigma auch für das Verhältnis aller wirklichen Religion zur
Christusbotschaft.
In der letzten Zeit ist mir in
persönlichen
Gesprächen in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder die
Frage
begegnet, in welchem Sinn die christliche Botschaft einen
Absolutheitsanspruch
erhebt und womit sie ihn begründet. Diese Fragen meiner
Gesprächspartner
stehen am Ursprung der folgenden Überlegungen, in denen auch eine
Reihe von Texten ausführlich zitiert werden sollen. Zugleich
schließen
diese Überlegungen an einen früheren Beitrag zu einem
Symposium
über den Offenbarungsbegriff in Indien an, das vom 22. bis 26.
Februar
1973 am Indologischen Institut der Universität Wien stattfand(1).
I. Infragestellung eines religiösen Absolutheitsanspruchs
Auch in unserem Jahrhundert begegnen immer wieder religiös begründete gewaltsame Auseinandersetzungen, die eigentlich im Widerspruch zu Grundaussagen der Religionen selbst zu stehen scheinen. Die Gefahr solcher Auseinandersetzungen führt häufig zur Infragestellung jeden Rechts auf Mission.
Im Buddhismus findet man demgegenüber den Rat, sich überhaupt von allen religiösen Streitgesprächen fernzuhalten. Möglicherweise »ist der Buddhismus die einzige Weltreligion, die sich, ohne jemals Gewalt anzuwenden, nur durch Überzeugung ausbreitete«(2). Dies macht den Buddhismus außerordentlich sympathisch.
Bekannt ist das »Elefantengleichnis«. Es war einmal, so erzählt der Buddha, »ein König in Benares. Der sammelte, um sich zu vergnügen, eine Menge Bettler um sich, die blind von Geburt waren, und versprach demjenigen einen Preis, der ihm die beste Beschreibung eines Elefanten geben könne. Der erste Bettler, der den Elefanten untersuchte, tastete zufällig den Schenkel ab und meinte, ein Elefant sei ein Baumstamm. Der zweite erfaßte den Schwanz und erklärte, ein Elefant sei etwas Seilähnliches; ein anderer, der das Ohr anfühlte, behauptete, ein Elefant sei so etwas wie ein Palmenblatt, und so weiter. Die Bettler gerieten miteinander in Streit, und der König amüsierte sich köstlich.«(3) Der Buddha sagte auch: »Während einer behauptet, daß sich in seiner eigenen Lehre feste Sicherheit findet, hält er seinen Gegner für einen Toren; so verursacht er Zwistigkeiten, da er seinen Gegner töricht und unrein nennt«(4).
Berühmt ist ferner die Parabel des Buddha von dem von einem Giftpfeil verletzten Menschen: Der von dem Giftpfeil Getroffene wird eilends zu einem Arzt gebracht, der den Pfeil sofort herausziehen will. Doch der Verwundete läßt dies nicht zu, sondern ruft: »Nicht eher soll der Pfeil herausgezogen werden, bis ich jenen Mann kenne, der mich getroffen hat, welcher Familie er angehört, ob er groß, klein oder von mittlerer Gestalt ist, ob seine Hautfarbe schwarz, braun oder gelb ist ...«. Wie der vom Giftpfeil Getroffene sterben würde, bevor er die Antwort auf seine Fragen in Erfahrung bringen könnte, ebenso würde der heilsbegierige Jünger vor der Lösung aller metaphysischen Fragen den Leiden dieser Welt erliegen(5).
Die buddhistische Ablehnung religiöser Spekulationen geht vor allem in zwei Richtungen: »Erstens: Erörtere nichts, was wir nicht mit Sicherheit wissen können; zweitens: Erörtere nichts, was zu wissen für uns unnütz und wertlos ist.«(6)
Gotthold Ephraim Lessing hat das Verhältnis zwischen Juden, Christen und Muslimen in seinem dramatischen Gedicht »Nathan der Weise« mit der Ringparabel darzustellen versucht(7). Ein »Ring von unschätzbarem Wert«, der seinen Träger Gott und den Menschen lieb macht, wird seit Generationen immer vom Vater auf seinen liebsten Sohn vererbt:
»So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn,Um keinen seiner Söhne zu kränken, läßt der Vater von einem Künstler zwei weitere gleiche Ringe anfertigen. Als dieser ihm die Ringe bringt, kann der Vater selber den Musterring nicht mehr unterscheiden. Die Anwendung auf die Religionen lautet: So sehr diese in ihren Riten »bis auf die Kleidung, bis auf Speis' und Trank« unterscheidbar sind, bleiben sie in ihren Gründen ununterscheidbar:
Auf einen Vater endlich von drei Söhnen;
Die alle drei ihm gleich gehorsam waren,
Die alle drei er folglich gleich zu lieben
Sich nicht entbrechen konnte. [...]«
»Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte?Die Söhne verklagen sich nun gegenseitig, und jeder schwört dem Richter, den Ring unmittelbar aus seines Vaters Hand zu haben, was ja auch wirklich der Fall ist:
Geschrieben oder überliefert! Und
Geschichte muß doch wohl allein auf Treu
Und Glauben angenommen werden? Nicht?
Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn
Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen?
Doch deren Blut wir sind? doch deren, die
Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe
Gegeben? die uns nie getäuscht, als wo
Getäuscht zu werden uns heilsamer war?
Wie kann ich meinen Vätern weniger
Als du den deinen glauben? Oder umgekehrt.
Kann ich von dir verlangen, daß du deine
Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht
Zu widersprechen? Oder umgekehrt.
Das nämliche gilt von den Christen. Nicht? «
»[...] Der Vater,Da der verstorbene Vater nicht mehr gefragt werden kann und an den Ringen selbst kein Unterschied zu erkennen ist, will der Richter die Söhne fortweisen; da kommt ihm der rettende Gedanke:
Beteu'rte jeder, könne gegen ihn
Nicht falsch gewesen sein; und eh er dieses
Von ihm, von einem solchen lieben Vater,
Argwohnen laß': eh müß' er seine Brüder,
So gern er sonst von ihnen nur das Beste
Bereit zu glauben sei, des falschen Spiels
Bezeihen; und er wolle die Verräter
Schon auszufinden wissen; sich schon rächen.«
»Doch halt! Ich höre ja, der rechte RingAngesichts der Ununterscheidbarkeit der Ringe bleibt am Schluß nur der Rat, ein jeder der Söhne solle zusehen, die Kraft seines Ringes durch das eigene Leben zu erweisen, ja geradezu ihm erst durch das eigene Leben Kraft zu verleihen:
Besitzt die Wunderkraft beliebt zu machen;
Vor Gott und Menschen angenehm. Das muß
Entscheiden! Denn die falschen Ringe werden
Doch das nicht können! Nun; wen lieben zwei
Von euch am meisten? Macht, sagt an! Ihr schweigt?
Die Ringe wirken nur zurück? und nicht
Nach außen? Jeder liebt sich selber nur
Am meisten? O, so seid ihr alle drei
Betrogene Betrieger! [...]«
»[...] Wohlan!Lessings »Nathan der Weise« ist 1779 erschienen. Auf der Ebene seiner Problemstellung erscheint die christliche Religion als eine Religion wie alle anderen. Das Erstaunliche an Lessings Text ist nur, daß es hier nicht mehr die Religion ist, die dem Menschen menschlich zu sein hilft. Vielmehr ist es der Mensch selbst, welcher seiner jeweiligen Religion, wie Lessing ausdrücklich formuliert, »zu Hilfe kommen« muß. Der Mensch selbst muß seiner Religion durch seine Taten zur Überzeugungskraft verhelfen. Trifft auf solche »Religion« nicht Karl Barths Bedenken zu, sie sei der menschliche Versuch, aus eigener Kraft das Heil zu erreichen?(8)
Es eifre jeder seiner unbestochnen,
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag
Zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hilf! [...]«.
Jedenfalls lassen die bisher genannten
Beispiele
aus der Gegenwart und aus der Geschichte, aus der Bibel und aus der
Literatur
einen Absolutheitsanspruch welcher Religion auch immer als recht
fragwürdig
erscheinen. Soll man nicht jeden lieber »nach seiner Façon
selig werden« lassen, wie es Friedrich der Große einmal
formuliert
hat(9)?
II. Gibt es dennoch einen christlichen Absolutheitsanspruch?
In den Urkunden des christlichen Glaubens wird durchaus ein Absolutheitsanspruch erhoben. In bezug auf Jesus heißt es: »In keinem anderen ist Heil; auch gibt es keinen anderen Namen unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, durch den wir gerettet werden sollen« (Apg 4,12). Ähnlich steht in dem Hymnus des Philipperbriefs: »Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: ,Jesus Christus ist der Herr' zur Ehre Gottes des Vaters.« (Phil 2,911).
Die beiden genannten Texte könnten noch in dem Sinn verstanden werden, daß die Christen für sich selbst von der alles umfassenden Bedeutung Jesu überzeugt sein mögen, ohne daß daraus bereits folgte, daß sie diesen Glauben auch anderen Menschen zu verkünden hätten. Aber das Matthäusevangelium schließt mit dem Auftrag des Auferstandenen: »Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.« (Mt 28,1820) Dieser Text wurde stets als die Begründung christlicher Mission verstanden. Nach ihrem Selbstverständnis will die christliche Botschaft weltweit verkündet werden. Denn für sie ist Gott der Schöpfer der ganzen Welt; und dieser Gott will das Heil aller Menschen (1 Tim 2,4). Gott hat in Jesus Christus »die Welt mit sich versöhnt« und unter uns den »Dienst der Versöhnung« eingesetzt, der darin besteht, das »Wort der Versöhnung« weiterzusagen: »Laßt euch versöhnen mit Gott« (vgl. 2 Kor 5, 1720). Die Autorität dieses »Wortes Gottes« läßt sich nur in der Weise der Bitte oder der Einladung wahrnehmen(10). Aber jedenfalls gilt: »Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben.« (Apg 4,20)
Wie kann aber ein Absolutheitsanspruch erhoben werden, ohne die religiösen Gefühle Andersgläubiger zu verletzen? Dieser Frage kommt heute aufgrund der so stark vermehrten Berührungsmöglichkeiten zwischen den Religionen große Wichtigkeit zu; in der Bundesrepublik Deutschland stellt sie sich in besonderem Maß aufgrund der Einwanderung von zahlreichen Anhängern anderer Religionen.
Und wie kann ein Absolutheitsanspruch noch erhoben werden, ohne durch Lessings Ringparabel entkräftet zu werden?
Die Antwort auf diese Frage ist impliziert in Jesu Gleichnissen vom barmherzigen Samariter (Lk 10,2536) und vom Weltgericht (Mt 25,3146). Dem Samariter werden für sein Eingreifen zugunsten des unter die Räuber Gefallenen keinerlei religiöse Gründe zugeschrieben; das Verhalten (»sah ihn und ging vorüber«) der Religiösen, des Priesters und des Leviten, wird in Frage gestellt. Bei Matthäus bildet das Gleichnis vom Weltgericht den Abschluß und damit so etwas wie den Höhepunkt und die Zusammenfassung der Reden Jesu (vgl. Mt 26,1). Es heißt in diesem Gleichnis, der König werde denen zu seiner Rechten sagen: »Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.«
Diese Texte scheinen zu besagen, daß letztlich nicht einmal mehr die ausdrückliche Bezugnahme auf Jesus zählt, sondern nur dasjenige Handeln, das nicht von der Angst des Menschen um sich selbst geleitet ist und dem anderen Menschen in Wahrheit gerecht wird. Solches Handeln ist allerdings in Wahrheit Folge und Ausdruck, nicht Voraussetzung und Grund der Gemeinschaft mit Gott; und diese kann sich ereignen, ohne daß Christus selbst je erwähnt wird.
In unseren weiteren Überlegungen soll
dargestellt
werden, was es bedeutet, daß sich die christliche Botschaft nicht
als »Gesetz«, sondern als »Evangelium«
versteht.
Sie will den Menschen aus der Macht der Angst um sich selbst befreien,
die ihn sonst daran hindert, menschlich zu sein. Sie bringt kein neues
Gesetz mit sich, sondern geht auf dasjenige Gesetz ein, unter dem der
Mensch
bereits aufgrund seines Menschseins steht. Dieses Gesetz besteht in dem
sittlichen Anspruch, nicht unmenschlich, sondern menschlich zu sein.
III. Gegen »exklusive« und »inklusive Intoleranz«
Es wird zunächst notwendig sein, zwei falschen Interpretationen des christlichen Absolutheitsanspruchs gegenüber den anderen Religionen zu entgehen. Sie lassen sich mit den Stichworten »exklusive« und »inklusive Intoleranz« kennzeichnen.
»Exklusive Intoleranz« bestünde darin, für die christliche Botschaft in dem Sinn Wahrheit zu behaupten, daß alle anderen Religionen »falsch« wären. Daß die christliche Botschaft einen solchen Anspruch nicht erhebt, erkennt man bereits daraus, daß sie in den Kanon ihrer Heiligen Schrift das gesamte Corpus der Heiligen Schrift der jüdischen Religion integriert hat. Sie kann also die jüdische Religion nicht als eine »falsche« Religion betrachten. Und nach Paulus gehören alle, die glauben, »zu dem glaubenden Abraham und werden wie er gesegnet« (Gal 3,9).
Als Paulus in das heidnische Athen kommt und die Heiligtümer der Stadt anschaut, findet er einen Altar mit der Aufschrift: »Einem unbekannten Gott«. Daran knüpft er seine Verkündigung an: »Was ihr verehrt, ohne es zu erkennen, das verkünde ich euch.« (Apg 17,23) Auch hier ist die Voraussetzung, daß die Religion der Athener nicht einfachhin »falsch« sein kann.
Das II. Vatikanum lehrt in seiner Kirchenkonstitution, daß »alle Menschen zum neuen Gottesvolk gerufen werden. Darum muß dieses Volk eines und ein einziges bleiben und sich über die ganze Welt und durch alle Zeiten hin ausbreiten. So soll sich das Ziel des Willens Gottes erfüllen, der das Menschengeschlecht am Anfang als eines gegründet und beschlossen hat, seine Kinder aus der Zerstreuung wieder zur Einheit zu versammeln (vgl. Joh 11,52).« Diejenigen nun, »die das Evangelium noch nicht empfangen haben«, seien auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hingeordnet: »In erster Linie jenes Volk, dem der Bund und die Verheißungen gegeben worden sind und aus dem Christus dem Fleische nach geboren ist (vgl. Röm 9,45), dieses seiner Erwählung nach um der Väter willen so teure Volk: die Gaben und Berufung Gottes nämlich sind ohne Reue (vgl. Röm 11,2829). Der Heilswille umfaßt aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten wird. Aber auch den anderen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, auch solchen ist Gott nicht ferne, da er allen Leben und Atem und alles gibt (vgl. Apg 17,2528) und als Erlöser will, daß alle Menschen gerettet werden (vgl. 1 Tim 2,4).« (Lumen Gentium 16)
Die Kirche anerkennt also, daß sowohl die jüdische Religion wie die des Islam den einen wahren Gott verehren. Sie erklärt darüber hinaus ausdrücklich, daß auch, »wer das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, das ewige Heil erlangen kann« (ebd.).
In der »Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen« sagt das II. Vatikanum: »Die Kirche lehnt nichts von alldem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet.« (Nostra Aetate 2,2)
Ein kompromißloses Nein sagt die christliche Botschaft nur zu allen Formen von Weltvergötterung; deshalb ihre Ablehnung des römischen Kaiserkults oder des Absolutheitsanspruchs moderner Diktatoren. Aber auch für dieses tatsächlich »exklusiv intolerante« Nein stehen der christlichen Botschaft keine anderen Machtmittel zur Verfügung als das aufdeckende Wort und die Bereitschaft, um dieses Wortes willen Verfolgung zu ertragen.
Man kann also feststellen, daß gegenüber anderen Religionen die christliche Botschaft nicht im Sinn einer »exklusiven Intoleranz« verstanden werden will. Wo ihr Anspruch in der Geschichte doch in einem solchen Sinn vertreten worden ist, handelte es sich um eine tragische Verkennung und Verfälschung, um ein völliges Verhaftetbleiben in einer Mentalität, die durch den christlichen Glauben gerade überwunden werden soll(11).
Aber auch eine »inklusive Intoleranz« wäre für die anderen Religionen im Grunde unerträglich. »Inklusive Intoleranz« bestünde in der Meinung, die anderen Religionen hätten jeweils Teile der Wahrheit; aber nur das Christentum umfasse die ganze Wahrheit. Damit würden die anderen Religionen vereinnahmt. Könnte dann nicht genausogut irgendeine andere Religion das Christentum vereinnahmen, indem sie erklärt, ihrerseits die ganze Wahrheit zu vertreten, während das Christentum und alle anderen Religionen jeweils nur Teilwahrheiten besitzen? Zum Beispiel werden in der Sicht des Islam Judentum und Christentum wenigstens als Religionen »des Buches« anerkannt, aber die volle und unverkürzte Wahrheit sei erst im Islam selbst gegeben(12).
Wie will man einen solchen Anspruch irgendeiner Religion entkräften? Vielleicht besteht die einzige Widerlegung genau in dem Vorwurf, es handele sich um eine Vereinnahmung, die jeden Dialog unmöglich machen würde. Angenommen z. B., man wollte aus islamischer Sicht es für göttlich geoffenbart halten, die christliche Trinitätslehre leugne die Einzigkeit Gottes. Dann könnten Christen mit so vielen Argumenten sie wollen erläutern, warum sie sich von einer solchen Diagnose nicht getroffen fühlen; es würde ihnen nichts nützen. Und ähnlich ginge es den anderen Religionen gegenüber einer christlichen »inklusiven Intoleranz«. Selbstverständlich ist zwar jede Seite von der Gültigkeit der eigenen Argumente felsenfest überzeugt; aber damit ist nichts darüber gesagt, ob diese Argumente auch die anderen überzeugen. Denen, die von irgendwelchen Argumenten nicht überzeugt werden, könnten ihre Gesprächspartner natürlich Dummheit oder Bosheit zuschreiben wollen; aber damit wird zum einen für das Gespräch nichts gewonnen, und zum anderen werden die Argumente selbst dadurch durchaus nicht überzeugender.
Es empfiehlt sich wohl, auch die Haltung der
»inklusiven
Intoleranz«, weil bereits innerweltlich heillos, völlig
aufzugeben.
Statt dessen ist die Bereitschaft zu einem wirklichen Gespräch
zwischen
den Religionen gefordert. Man soll dafür bereit werden,
voneinander
sowohl für die Vertiefung der je eigenen Auffassung wie für
deren
verständlichere Erläuterung für den anderen zu lernen.
IV. Eine andere Absolutheit(13)
Auch die Formulierungen des II. Vatikanums könnten weithin noch immer den Eindruck erwecken, genau eine solche »inklusive Intoleranz« zu vertreten. In der Kirchenkonstitution (Lumen Gentium 1416) wird das Bild von konzentrischen Kreisen entwickelt: Den innersten Kreis bilden die Gläubigen der katholischen Kirche, dann kommen die anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften, die immerhin noch »vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit« (Lumen Gentium 8,2) enthalten. Die zugrundeliegende Vorstellung ist, daß sich das Ganze des Glaubens aus einer Vielzahl von Elementen zusammensetzt, die vollständig beisammen sein müssen, wenn der Glaube vollkommen sein soll. Einen weiteren Kreis bilden die Juden, einen noch weiteren die Muslime. Danach kommen die anderen Religionen. Und schließlich kommen diejenigen, »die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu führen sich bemühen« (Lumen Gentium 16).
Gibt es dennoch die Möglichkeit, solche Aussagen anders als im Sinn einer »inklusiven Intoleranz«, einer Vereinnahmung der anderen Religionen zu verstehen? Könnte daran sogar das eigentliche Verständnis der christlichen Botschaft selbst hängen?
Im folgenden soll die These vertreten und erläutert werden, daß die christliche Botschaft in der Begegnung mit den Religionen deren je eigene Wahrheit in ihrer Unüberbietbarkeit zur Geltung bringen will. Die christliche Botschaft will letztlich nichts anderes, als über die Unüberbietbarkeit wahrer Religion überhaupt Rechenschaft geben. Es handelt sich also geradezu um das Gegenteil zu der Meinung, es sei die christliche Botschaft, welche die anderen Religionen überbiete. Vielmehr geht es um die Unüberbietbarkeit der anderen Religionen selbst in ihrer je eigenen Wahrheit.
Eine solche Sicht ist heute noch so
ungewohnt,
daß sie ständig Gefahr laufen wird, noch immer mit
»inklusiver
Intoleranz« verwechselt zu werden, einfach weil man sich
zunächst
außer »exklusiver« und »inklusiver
Intoleranz«
gar keine weitere Möglichkeit eines Absolutheitsanspruchs
vorstellen
kann.
V. Das Problem des Vorverständnisses
In der Tat gibt es in einem bestimmten und wohl als herrschend zu charakterisierenden Vorverständnis keine weitere Möglichkeit. Es handelt sich um ein Vorverständnis, das von den Anhängern der meisten Religionen und wohl auch von der weit überwiegenden Zahl der Christen völlig selbstverständlich vorausgesetzt wird. Dieses ungeprüfte Vorverständnis besteht in der vermeintlich selbstverständlichen Auffassung, daß Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, sich natürlich auch offenbaren könne. Was erscheint selbstverständlicher als dies! Denn wenn es Gott gibt und er allmächtig ist, warum sollte er sich nicht auch offenbaren können? Wer wollte ihm dies verbieten?
In diesem Vorverständnis ist der Offenbarungsbegriff von vornherein vermeintlich problemlos. Daß eine Offenbarung prinzipiell möglich ist, steht so sehr außer Frage, daß als einziges Problem bleibt, ob und wo eine solche Offenbarung tatsächlich ergangen ist und wieweit man denen trauen kann, die sie weitergeben. Weil nämlich der Offenbarungsbegriff so selbstverständlich ist, könnte ja »jeder kommen« und sich auf eine Offenbarung berufen. Um die Echtheit einer angeblichen Offenbarung zu beweisen, bedarf es deshalb sozusagen »flankierender Maßnahmen«, außergewöhnlicher Begleitumstände. Man muß also zunächst historisch feststellen, daß an einer bestimmten Stelle eine göttliche Offenbarung ergangen ist; und dann muß man sie annehmen, welchen Inhalt auch immer sie hat.
Unter dieser Voraussetzung der selbstverständlichen Möglichkeit einer Offenbarung dürften sich alle Religionen einschließlich des Christentums in mehr oder minder der gleichen Situation befinden. Sie müssen ihrem jeweiligen Anspruch durch alle möglichen Glaubwürdigkeitsbeweise »zu Hilfe kommen«. Aber damit kann man der jeweiligen Religion (wie auch dem Christentum selbst) nur einen Bärendienst leisten. Denn es wird nicht verständlich, wie solche Glaubwürdigkeitsbeweise ausreichen sollen, um eine Gewißheit im Leben und Sterben zu begründen, um die es doch letztlich in jeder Religion geht.
Wäre zum Beispiel die christliche Botschaft überzeugend, wenn man sich der Wahrheit der Auferstehung nur durch einen »prüfenden Blick« in das leere Grab zu vergewissern hätte und wenn man als Begründung für eine Glaubensgewißheit, die im Leben und Sterben Bestand haben soll, sagen müßte: »Die Apostel waren gesunde, nüchterne Männer aus dem Volk, die durch ihre Tätigkeit in der frischen Luft am See nicht für subjektive Halluzinationen empfänglich waren«(14)?
In der Sicht der christlichen Botschaft selbst ist das genannte Vorverständnis geradezu als »erbsündlich« zu bezeichnen. Es ist dasjenige Vorverständnis, in welchem der Mensch sich von sich aus versteht. Es besteht darin, Gott und Welt unter das gleiche Wirklichkeitsverständnis zu subsumieren und damit Gott zu einem Faktor zu machen, mit dem man »rechnen oder nicht rechnen« muß, je nachdem, ob man ihn für existierend hält oder nicht. Ein solcher Gott ist gar nicht Gott, sondern ein Stück ins Unendliche projizierter Weltwirklichkeit.
In diesem Vorverständnis wird verkannt, daß die christliche Botschaft zu ihrer wirklichen Annahme eine Bekehrung erfordert, die auch das Vorverständnis selber umfaßt. »Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid; denn der neue Stoff reißt doch wieder ab, und es entsteht ein noch größerer Riß. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche. Sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus, und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten.« (Mt 19,1617).
Die christliche Botschaft wird
überhaupt
nur unter der Bedingung verstehbar, daß man auch das bisherige
Vorverständnis
in Frage stellt, anstatt zu versuchen, sie darin einzuordnen. Man
muß
aufhören, die Möglichkeit von Offenbarung und damit die
Möglichkeit
von Gemeinschaft mit Gott für eine platte
Selbstverständlichkeit
zu halten. Denn genau dadurch werden die Grundaussagen des Glaubens,
die
eigentlichen Glaubensgeheimnisse, allesamt unverständlich.
VI. Natürliche Gotteserkenntnis aus der Schöpfung
In überhaupt allen Religionen geht es um die Frage des Heils, um eine letzte, durch nichts anderes mehr zu relativierende Geborgenheit. Insofern sind alle Religionen auf eine Unüberbietbarkeit ausgerichtet, oder sie sind keine Religionen. Dieser Satz will sehr genau bedacht werden.
Der Satz schließt sich an die berühmte Begriffsbestimmung bei Anselm von Canterbury an, wonach über Gott hinaus »nichts Größeres gedacht werden kann«, ja Gott »größer ist als alles, was gedacht werden kann«(15). Und im Glauben geht es dann um die Gemeinschaft mit diesem Gott. Anselm von Canterbury hatte für dieses Gottesverständnis beansprucht, es werde von Juden und Heiden geteilt(16).
Wenn wir in bezug auf Gott sagen, er sei größer als alles, was gedacht werden kann, dann klingt diese Aussage zunächst wie ein Selbstwiderspruch. Versucht sie nicht das Undenkbare doch zu denken, das, was nicht unter Begriffe fällt, unter einen Begriff zu fassen? Die Aussage könnte nur dann sinnvoll sein, wenn sie ursprünglich und ihrem Grunde nach eigentlich eine Aussage über die Welt ist und so die Unbegreiflichkeit Gottes wahrt.
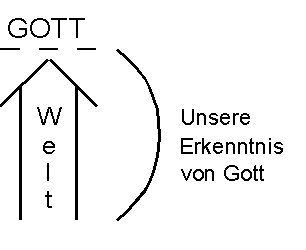
Genau dies meint auch die Aussage der christlichen Botschaft, daß die Welt »aus dem Nichts geschaffen sei«. In allem, worin sich die Welt vom Nichts unterscheidet, ist sie solcherart, daß sie ohne Gott nicht wäre. Es sei hier nur darauf hingewiesen, daß dies ein völlig anderer und ungleich radikalerer Sachverhalt ist, als die ganz unzureichende Vorstellung von einem »Urknall«, dem eine Art totales Vakuum vorausgegangen wäre. »Aus dem Nichts Geschaffensein« meint die gesamte Wirklichkeit in ihrer ganzen zeitlichen Erstreckung und in jeder Hinsicht und damit auch die gegenwärtige Wirklichkeit und uns selber vor Gott.
Das Sprechen von Gott bedeutet deshalb ein Aufbrechen des normalen Gebrauchs unserer Sprache. Gewöhnlich gebrauchen wir unsere Begriffe in der Weise, daß das damit Gemeinte jeweils »unter« diese Begriffe fällt. Aber das Woraufhin des restlosen Bezogenseins der Welt fällt nicht mehr »unter« unsere Begriffe, sondern wir können von ihm nur noch »analog«, »hinweisend« sprechen. Wenn wir Gott unendliche, absolute Wirklichkeit und Vollkommenheit zuschreiben, dann sagen wir unmittelbar nur aus, daß alle andere Wirklichkeit und Vollkommenheit solcher Art ist, daß sie ohne ihn nicht wäre.
Mit »Analogie« ist also nicht eine Art diffus gemeinsamer, Gott und Welt übergreifender Seinsbegriff gemeint, sondern ein Sprechen aufgrund der völlig einseitigen Bezogenheit der Welt auf Gott, die auch nur eine einseitige Ähnlichkeit ihm gegenüber auszusagen gestattet. Nur bei einer solchen einseitigen Ähnlichkeit wird die berühmte Analogieformel des IV. Laterankonzils (1215) verständlich: »Zwischen Schöpfer und Geschöpf kann keine Ähnlichkeit ausgesagt werden, ohne daß eine noch größere Unähnlichkeit ausgesagt werden muß.«(17)
Ein solches Gottesverständnis unterscheidet sich grundlegend von einer Projektion. Bei einer Projektion ist wie bei einem Dia und dem vergrößerten Bild an der Wand die Ähnlichkeit immer wechselseitig, und sie geschieht innerhalb eines übergreifenden Systems. Es gibt aber kein Gott und Welt übergreifendes System.
Durch die Betonung dieser Einsicht bringt die christliche Botschaft so etwas wie eine »neue Philosophie« mit sich, nämlich die Forderung einer »relationalen Ontologie«. Diese unterscheidet sich von der sonst weithin üblichen »Substanzmetaphysik« dadurch, daß sie die Kategorie der »Relation« nicht grundsätzlich derjenigen der Substanz nachordnet. Vielmehr impliziert die Rede von einem »Aus-dem-Nichts-Geschaffensein« der Welt, daß die Relation des Geschaffenen auf Gott das Eigensein des Geschaffenen überhaupt erst begründet und ihm in diesem Sinn vorgeordnet ist.
Wenn »Geschaffensein aus dem Nichts« bedeutet, daß die Welt restlos und damit in einem einseitigen Bezogensein auf Gott aufgeht, dann ist die Behauptung nicht mehr selbstverständlich, daß Gott sich seinerseits auf die Welt beziehe. Die Behauptung einer realen Relation Gottes auf die Welt, für welche die Welt der sie als Relation konstituierende Terminus wäre, liefe auf die Leugnung des Geschaffenseins aus dem Nichts hinaus. Deshalb hat insbesondere die Hochscholastik immer die Einseitigkeit der realen Relation der Welt auf Gott [vorher Druckfehler: Gottes auf die Welt] gelehrt(18), ohne allerdings wirklich zu bedenken, wie damit ein banal selbstverständlicher Offenbarungsbegriff oder überhaupt die sonst vermeintlich problemlose Vorstellung von einem Eingreifen Gottes in die Welt in Frage gestellt wird. Denn wie sollte eine von vornherein »restlose Abhängigkeit« aller Wirklichkeit noch gleichsam überboten werden können? Wie kann also ausgesagt werden, daß Gott sich der Welt zugewandt oder sich ihr offenbart hat und ihr Barmherzigkeit und Liebe erweist? Der Offenbarungsbegriff hat seine banale Selbstverständlichkeit verloren.
Das Wort »selbstverständlich« kann aber in zwei völlig entgegengesetzten Bedeutungen verstanden werden. »Selbstverständlich« ist für gewöhnlich das, was man von selber versteht, was man also in das eigene Vorverständnis problemlos einordnen kann. Solange man für eine Religion mit dem Versuch eintreten will, sie in diesem Sinn der banalen Selbstverständlichkeit »plausibel« zu machen, kann man ihr letztlich nur einen Bärendienst leisten. Gegen Versuche, die christliche Botschaft oder sonst eine Religion in diesem Sinn »plausibel« zu machen, wird rechte Theologie immer erneut angehen müssen.
Aber das Wort
»selbstverständlich«
läßt noch einen anderen, dem ersten geradezu
entgegengesetzten
Sinn zu. Wenn ein Offenbarungsanspruch nicht mehr für banal
selbstverständlich
gehalten wird, ja wenn er eigentlich inhaltlich als völlig
unmöglich
erscheinen muß, dann kann er nur noch sich selber
verständlich
machen. Ein angebliches »Wort Gottes« muß durch
seinen
Inhalt erläutern, wie man es überhaupt als »Wort
Gottes«
soll verstehen können. »Wort« ist ja mitmenschliche
Kommunikation.
Wie kann ein menschliches Wort zugleich Gottes Selbstzusage sein?
VII. Gottes Selbstmitteilung im Wort
Die christliche Botschaft antwortet tatsächlich gerade durch ihren Inhalt auf die Frage, wie man sie überhaupt als Wort Gottes verstehen kann.
Zunächst ist für die christliche Botschaft alles von Gott Verschiedene bloße Welt und als solche Gegenstand der Vernunft. Hierher gehört auch der sittliche Anspruch, unter dem überhaupt jeder Mensch von vornherein steht, nämlich menschlich und nicht unmenschlich zu sein. Dieser Anspruch wird aus der Wirklichkeit selbst erkannt und bedarf letztlich keiner Offenbarung. Nach der christlichen Tradition werden die Normen unseres Handelns nicht geglaubt, sondern man muß für sie mit Vernunft argumentieren. Der sittliche Anspruch hat mit Gott nur im gleichen Sinn zu tun, wie überhaupt die ganze Wirklichkeit, die ja das ist, was ohne ihn nicht sein kann. Ohne die Anerkennung unserer Geschöpflichkeit wäre das Wort »Gott« nicht verständlich. Aber »Wort Gottes« im eigentlichen Sinn ist noch etwas anderes.
Wie ist Offenbarung im eigentlichen Sinn zu
verstehen?
Nach der christlichen Botschaft kann sie nur in der Selbstmitteilung
Gottes
bestehen, also darin, daß Gott mit sich selbst Gemeinschaft
schenkt.
Um dies verständlich zu machen, erläutert die christliche
Botschaft
zunächst, man könne eine reale eziehung Gottes auf die Welt
nur
aussagen, wenn diese Beziehung von Ewigkeit her in Gott die Liebe
Gottes
zu Gott, des Vaters zum Sohn, nämlich der Heilige Geist ist. Um
Gemeinschaft
mit Gott
auszusagen, bedarf es des trinitarischen
Gottesverständnisses.
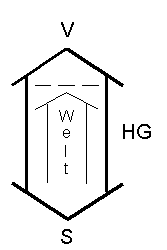
Denn wollte man eine Beziehung Gottes auf die Welt behaupten, deren konstitutiver Terminus die Welt ist, dann hätte man bereits das Aus-dem-Nichts-Geschaffensein der Welt geleugnet. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn man meinte, Gottes Liebe zu uns Menschen hänge von Bedingungen ab, die wir zu erfüllen haben. Dann könnte man sich ja auch auf Gottes Liebe nicht mehr als auf sich selbst verlassen, und die Gemeinschaft mit Gott könnte den Menschen keineswegs aus dem Zwang der Angst um sich selbst befreien.
Weil nach der christlichen Botschaft Gottes Liebe zur Welt nicht an der Welt und damit an überhaupt nichts Geschaffenem ihr Maß hat, kann man sie auch nicht an der Welt ablesen. Sie bliebe verborgen, würde sie nicht in der Weise des Wortes dazugesagt.
Weil aber Wort mitmenschliche Kommunikation ist, wird der Begriff »Wort Gottes« nur dann definitiv sinnvoll, wenn man sich für ihn auf eine Menschwerdung Gottes berufen kann. An Jesus als den Sohn Gottes glauben bedeutet, aufgrund seines Wortes sich von Gott mit der Liebe angenommen zu wissen, in der Gott ihm als seinem eigenen Sohn von Ewigkeit her zugewandt ist.
Der Glaube an die Gottessohnschaft Jesu stellt aber Jesus nicht himmelhoch über die anderen Menschen, sondern läßt die anderen Menschen vielmehr erfassen, wie unendlich groß Gottes Liebe zu ihnen ist. Gott hat keine andere Liebe als die zu seinem eigenen Sohn, und mit dieser Liebe sind alle Menschen von Gott angenommen.
Beide Aussagen, nämlich daß Gott ein einziger in den drei Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und daß der Sohn Mensch geworden ist, sind als Glaubensgeheimnisse die Möglichkeitsbedingung für eine Offenbarung.
Für uns Menschen bedeutet Personsein soviel wie die Grundfähigkeit zu Selbstbewußtsein und Selbstverfügung und damit zu Selbstbesitz. Nun spricht die christliche Botschaft von Gott als Vater, Sohn und Heiligem Geist, »drei Personen in einer Natur«. Auch in seiner analogen, hinweisenden Anwendung auf Gott läßt sich der Personbegriff im Sinn einer Selbstbezüglichkeit verstehen: Wir sprechen von Vater, Sohn und Geist als von drei untereinander verschieden vermittelten Relationen der einen göttlichen Wirklichkeit auf sich selbst, also drei verschiedenen Weisen des Selbstbesitzes dieser göttlichen Wirklichkeit. Damit ist jede Gefahr eines Tritheismus, einer Dreigötterlehre ausgeschaltet. Der Vater ist unmittelbare Relation der göttlichen Wirklichkeit auf sich selbst, ein erster göttlicher Selbstbesitz.
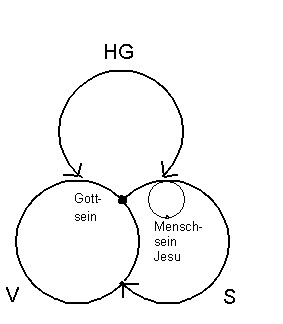
Und eine Menschwerdung des Sohnes kann nur so ausgesagt werden, daß der Mensch Jesus mit seinem menschlichen Grundselbstbesitz aufgenommen ist in den ewigen göttlichen Selbstbesitz des Sohnes. Dann ist Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch; Gottsein und Menschsein bleiben dabei voneinander verschieden, also »ohne Vermischung«, aber sie sind miteinander durch die Relation eines göttlichen Selbstbesitzes verbunden, sie existieren »ohne Trennung« voneinander(19). Durch Jesu menschliches Wort wird offenbar, daß die Welt von vornherein in die Liebe des Vaters zu ihm als dem Sohn hineingeschaffen ist.
Die christliche Botschaft behauptet, Wort Gottes zu sein. Daß diese Behauptung wahr ist, kann nur in einem Glauben erkannt werden, der das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist. Dieser Heilige Geist verbindet die Glaubenden mit Christus und untereinander, und in ihm haben sie Zugang zum Vater.
Gegenüber jeder beliebigen Botschaft könnte der Mensch von sich aus sie annehmen, ablehnen oder ihr gegenüber unentschieden bleiben. Eine Annahme der christlichen Botschaft aus eigener Kraft wäre aber nur entweder rationalistisch oder fideistisch. Es handelte sich dann um den Versuch, den Glauben entweder auf Vernunft zurückzuführen oder aber ihn durch einen bloßen Willensaufschwung zu erreichen. Eine solche Bejahung der christlichen Botschaft hätte nichts mit Glauben zu tun. Die Grenze zwischen Glauben und Unglauben liegt also nicht etwa zwischen einer solchen Bejahung der christlichen Botschaft und ihrer Ablehnung bzw. der Unentschiedenheit ihr gegenüber. Der Glaube kann nur dann als Gnade verstanden werden, wenn er sich nicht auf eine Leistung zurückführen läßt, sondern darauf beruht, daß die ganze Schöpfung von vornherein in die Liebe Gottes zu Gott, des Vaters zum Sohn hineingeschaffen ist. Deshalb wird die christliche Botschaft auch nur im Glauben als Wort Gottes erkannt; sie wird aber nicht erst durch den Glauben zum Wort Gottes gemacht.
Es ist somit erst der Inhalt der christlichen Botschaft, der ihren Anspruch, »Wort Gottes« zu sein, verstehbar werden läßt. Dieser Inhalt besteht in den Glaubensgeheimnissen der Dreifaltigkeit Gottes, der Menschwerdung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes.
Insofern sich der Heilige Geist als ein und derselbe in Christus und in den Christen erweist, könnte man wie von der »Menschwerdung« des Sohnes so von der »Kirchewerdung« des Heiligen Geistes sprechen(20).
Die Kirche ist dann die Gemeinschaft derer, die glauben und bekennen, daß jede wahre Gemeinschaft, in der Menschen selbstlos füreinander eintreten, vom Geist Gottes erfüllt ist. Der traditionelle Satz »Außerhalb der Kirche kein Heil«(21) bedeutet nicht eine Einschränkung des Heils auf die Christen, sondern besagt: Es gibt kein anderes Heil als das von der Kirche verkündete, das darin besteht, von Gott mit einer Liebe geliebt zu werden, die nicht an etwas Geschaffenem ihr Maß hat, sondern von Ewigkeit her die Liebe ist, mit welcher der Vater den Sohn liebt. Aber dieses Heil wird als die ganze Welt umfassend verkündet.
Unter Glaubensgeheimnissen sind also nicht unverständliche Aussagen zu verstehen, sondern gerade die entscheidenden Möglichkeitsbedingungen zum Verständnis des Glaubens. Sie werden als Glaubensgeheimnisse deshalb bezeichnet, weil sie nicht an der Welt ablesbar sind und nur so zur Kenntnis gelangen können, daß sie verkündet werden; und ihre Wahrheit wird nur in demjenigen Glauben erkannt, der, wie bereits erläutert, selber das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist.
Nach der christlichen Botschaft ist somit zwischen zwei Weisen der Gotteserkenntnis zu unterscheiden. Die eine besteht in der Anerkennung unserer Geschöpflichkeit: Gott ist der, »ohne den nichts ist«. Dies ist ablesbar an der Welt. Denn wir sind genau in dem Maß geschaffen, in dem wir sind. Diese Gotteserkenntnis wird traditionell als »natürliche Gotteserkenntnis«, als Gotteserkenntnis mit Hilfe der natürlichen Vernunft, bezeichnet. Sie führt aber im Grunde nur zu der Einsicht, daß Gott »im unzugänglichen Licht wohnt« (vgl. 1 Tim 6,16). Sie führt zu der Einsicht in die Unselbstverständlichkeit der Möglichkeit einer Gemeinschaft mit Gott. Für sich allein ist diese Gotteserkenntnis noch nicht wohltuend.
Die andere Weise der Gotteserkenntnis wird »übernatürlich« genannt. Sie besteht im Glauben an Gottes Selbstmitteilung, nämlich an die uns verkündete Liebe Gottes zu uns, die nicht an uns noch an irgend etwas Geschaffenem ihr Maß hat. Sie ist nicht an der Welt ablesbar, sondern wird uns nur durch das Wort kund und läßt sich nur im Glauben selber als wahr erfassen.
»Wort Gottes« ist die nunmehr offenbare Zuwendung Gottes zu seiner Schöpfung. Weil der Gott, der uns liebt, »der in allem Mächtige« ist, bedeutet Gemeinschaft mit ihm eine unbedingte Geborgenheit. Wer sich so von Gott geliebt weiß, wird nicht mehr aus der Angst um sich selber leben, die sonst der letzte Grund aller Unmenschlichkeit ist.
Nur von diesem Inhalt der christlichen
Botschaft
her läßt sich nun auch ihr genaues Verhältnis zu den
anderen
Religionen bestimmen.
VIII. Das Alte und das Neue Testament.
Das grundlegende Paradigma für das Verhältnis der christlichen Botschaft zu den Religionen ist das Verhältnis des Neuen Testaments zum Alten.
Die christliche Heilige Schrift ist überhaupt nur dadurch Heilige Schrift, daß sie in das »Alte« und das »Neue Testament« eingeteilt wird. Das »Neue Testament« kann sich als »neu« nur im Verhältnis zum »Alten Testament« erweisen; aber die Bezeichnung »Altes Testament« meint ihrerseits ein neues Verständnis dieses Textes, der jüdischen Heiligen Schrift.
Es handelt sich dabei um etwas völlig anderes als etwa eine Einteilung der Heiligen Schrift in einen ersten und in einen zweiten Teil, dem dann vielleicht noch ein dritter und weitere Teile zuwachsen könnten. Die Einteilung in »alt« und »neu« ist eine in sich abgeschlossene Aufteilung; darin drückt sich der Anspruch aus, es werde nie ein noch »neueres« Testament als das »Neue Testament« geben. Und das »Neue Testament« tritt nicht einfach additiv zu bereits vorhandenen Texten hinzu, sondern versteht sich selbst als deren endgültige Neuinterpretation.
Es ist also zu fragen, was genau mit der Heiligen Schrift der Juden geschieht, wenn sie vom »Neuen Testament« her als »Altes Testament« bezeichnet und damit paradoxerweise gerade nicht mehr wie bisher, sondern eben »neu« verstanden wird, und zwar in einer bleibenden Neuheit. Auch die Neuheit des »Neuen Testaments« kann nur zur Geltung kommen, wenn es dem »Alten Testament« gegenübergestellt wird und man das »Alte Testament« in seinem Licht zu lesen beginnt. Aber mit welchem Recht geschieht diese Neuinterpretation der Schrift Israels? Es ist dies eine Frage, die in der Theologiegeschichte erstaunlicherweise nur höchst selten gestellt worden ist.
Als die Sinnmitte der Schrift Israels möchte die Bundesformel erscheinen: »Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott«(22). Es geht in der jüdischen Religion letztlich um die Geborgenheit in der Gemeinschaft mit Gott. Demgegenüber müssen auch Christen zunächst bekennen: Mehr haben wir auch nicht. Es gibt nichts Größeres oder Höheres als Gemeinschaft mit Gott.
In der Tat will auch die christliche Botschaft nichts Höheres und Größeres aussagen als Gemeinschaft mit Gott. Sie stellt dabei nur die Frage, wie man zugleich die schlechthinnige Absolutheit Gottes wahren kann und dennoch Gemeinschaft mit einem solchen Gott aussagen kann. Durch diese Frage legitimiert die christliche Botschaft die Behauptung, die jüdische Heilige Schrift selbst erfordere eine Neuinterpretation. Die christliche Botschaft meint, daß Gemeinschaft mit Gott nur in der Weise möglich ist, daß wir Menschen in eine Liebe Gottes zu Gott aufgenommen sind.
Wenn die Schrift Israels im Licht des Glaubens an Jesus Christus gelesen wird, dann bedeutet dies nach Paulus, daß ihre eigene ursprüngliche und wahre Bedeutung voll an den Tag kommt. Paulus vergleicht das Geschehen bei der Lesung der Schrift Israels mit der Weise, wie nach Ex 34,29f Mose sein Angesicht verhüllte: »Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Hülle unaufgedeckt über dem Alten Bund, wenn sie ihn lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle weggenommen.«(23) (2 Kor 3,1516)
In dieser neuen christlichen Weise, den alten Text zu lesen, geschieht ein dreifacher Interpretationsschritt, für den die sich am Phänomen orientierenden Begriffe »Relativierung«, »Universalisierung« und »Erfüllung« vorgeschlagen seien.
»Relativiert« oder in Frage gestellt wird ein Verständnis des Textes, als sei die Rede von einem geschichtlichen Handeln Gottes in der Welt banal selbstverständlich im Sinn des oben erläuterten »erbsündlichen« Vorverständnisses. Ist es denn wirklich möglich, daß die Maße der Bundeslade auf einer göttlichen Offenbarung beruhen? Alles von Gott Verschiedene ist Welt und als solche nicht Gegenstand des Glaubens. Der Glaube kann sich nur auf Gottes Selbstmitteilung beziehen. So kann auch nur das göttliche Offenbarung sein, was den Charakter der Unüberbietbarkeit hat. Deshalb sagt der Hebräerbrief auch in bezug auf alle Opferriten: »Das Blut von Böcken und Stieren kann unmöglich Sünden wegnehmen.« (Hebr 10,4)
»Universalisiert« wird der Text in dem Sinn, daß die Heilige Schrift der Juden von der christlichen Botschaft überallhin mitgenommen wird, wohin sie selber gelangt. Denn dieser Text ist wie ein Spiegel des Menschen, dem das von Gott geschenkte Heil gilt. Die Probleme der Juden sind die Probleme der Menschen. Eines der Hauptthemen der jüdischen Heiligen Schrift ist das Problem der Gewalt von Menschen gegen Menschen. Dieser Text stellt den Menschen in seiner ganzen Erlösungsbedürftigkeit dar.
»Schrifterfüllung« als der eigentlich entscheidende Vorgang bedeutet, daß der Sinn definitiv an den Tag kommt, in welchem die Heilige Schrift der Juden wirklich für immer als »Wort Gottes«, als Selbstmitteilung Gottes in mitmenschlichem Wort verstanden werden kann. Mit »Schrifterfüllung« ist nicht gemeint, daß vorausgesagte Tatsachen eines Tages eintreffen, denn damit träte die Realisierung an die Stelle der Voraussage und man könnte die Voraussage hinter sich lassen. Vielmehr bedeutet Schrifterfüllung, daß der Schrifttext selbst nunmehr als definitiv sinnvoll verstanden werden kann, als Ausdruck des Glaubens an und der Gemeinschaft mit Gott.
Die Bundesformel »Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott« wird als vereinbar mit der Transzendenz Gottes erst verständlich und damit universal verkündbar, wenn Gottes Beziehung zu seinen Geschöpfen im voraus dazu die ewige Liebe des Vaters zum Sohn, nämlich der Heilige Geist ist. Wahr jedoch ist die Formel von vornherein, wenn sie in einem unüberbietbaren Sinn gelten soll.
In der Sicht der christlichen Botschaft gilt bereits vom Glauben Abrahams: Wenn Abraham sich in Gottes Liebe geborgen wußte, dann war er in die Liebe des Vaters zum Sohn aufgenommen. So war bereits sein Verhältnis zu Gott vom Heiligen Geist getragen.
Letztlich gilt: Durch Jesus wird nur offenbar, worin die wahre Situation der ganzen Welt vor Gott von vornherein besteht: Sie ist in die Liebe des Vaters zum Sohn hineingeschaffen. Durch die Menschwerdung des Sohnes wird Gottes Liebe zur Welt nicht größer, sondern sie wird in ihrer von vornherein bestehenden Unüberbietbarkeit offenbar (vgl. Röm 16,25f; Eph 3,9; Kol 1,1518).
Deshalb werden im Licht der christlichen
Botschaft
die Texte des Alten Testaments zum Ausdruck des christlichen Glaubens.
Zum Beispiel drückt der Psalm 23 »Mein Hirt ist Gott der
Herr«
unüberbietbar gültig diejenige Gemeinschaft mit Gott aus, um
die es im Glauben überhaupt geht. Auch der vorchristliche Glaube
ist
letzten Endes darauf zurückzuführen, daß die Welt von
vornherein
in die Liebe des Vaters zum Sohn hineingeschaffen ist.
IX. Der christliche Glaube und die anderen Religionen
Gerhard Ebeling hat aufgrund des geschichtlichen Erscheinungsbildes der Religionen die folgende Definition von Religion erarbeitet: »Religion ist [...] die geschichtlich geformte vielgestaltige Verehrung einer Manifestation des Geheimnisses der Wirklichkeit.«(24) Er erläutert, daß Religion sich auf ein Offenbarwerden dessen bezieht, »was das Geheimnis der Wirklichkeit ausmacht, was aber durch solche Manifestation den Charakter des Geheimnisses nicht einbüßt, vielmehr erst überhaupt kundmacht«(25). Durch die Wendung »Manifestation des Geheimnisses der Wirklichkeit« will er die Kategorie des »Heiligen« als des Erfahrungsgrundes von Religion umschreiben. Vom Heiligen ist aber erst dann in Wahrheit die Rede, wenn es in dem genannten Sinn als unüberbietbar verstanden wird.
In allen Religionen geht es letztlich um Gemeinschaft mit Gott. Selbst im Buddhismus, der nach Meinung vieler keinen persönlichen Gott zu kennen scheint, geht es um Geborgenheit im Nirvna: »Buddhisten suchen nicht nach bloßem Aufhören und Erlöschen, sondern nach Ewigem und Unsterblichen. [...] Nirvna ist ,unaussprechliche Seligkeit'.«(26)
Nun stellt die christliche Botschaft gegenüber allen Religionen die Frage, wie denn eine solche unüberbietbare Geborgenheit für uns sterbliche und vergängliche Menschen erreichbar sein soll. Keine geschaffene und damit doch prinzipiell überbietbare Qualität kann jemals ausreichen, eine unüberbietbare Geborgenheit zu begründen oder positiv zu ermöglichen. Wo immer diese Einsicht fehlt, verkommen alle Religionen auch die christliche Religion selbst! zu Magie und Aberglauben. Und umgekehrt ist dies das einzige Kriterium, durch das sich die Wahrheit der Religionen von Magie und Aberglauben scheiden läßt.
Der christliche Glaube hat deshalb die Struktur einer auch gegenüber sich selbst »religionskritischen« Religion(27). Nach dem Wort Jesu vom heidnischen Hauptmann »Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden« (Mt 8,10) gibt es auf der einen Seite kein »Recht dazu, den Frieden und die Freiheit, das Getröstetsein und die Gewißheit des Angenommen-, Bejaht- und Geliebtseins dort für ausgeschlossen zu halten, wo die Bedingung der Religionszugehörigkeit zum Christentum nicht erfüllt ist, ja wo nicht einmal eine Ahnung vom Christlichen besteht«(28). Auf der anderen Seite aber werden alle Religionen auf eine Wahrheit hin interpretiert, wonach das Heil alles menschliche Begreifen übersteigt, weil es an nichts Geschaffenem sein Maß haben kann. Daß Gottes Liebe zur Welt nicht von geschaffenen Bedingungen abhängig sein kann, macht das »Evangelium« aus, das die allen Religionen zugrundeliegende Wahrheit ist.
Der christliche Glaube ist sowohl in bezug auf das Christentum wie in bezug auf die anderen Religionen nur damit inkompatibel, daß geschaffene Leistungen oder Werke ausreichen sollen, das Heil zu erlangen. Für alle Religionen und für den Menschen überhaupt ist diese Unterscheidung von Aberglauben und Magie lebenswichtig.
Wenn die christliche Botschaft mit anderen Religionen in Dialog tritt, könnte der Gewinn auf beiden Seiten liegen. Paulus hat dadurch, daß er den Griechen ein Grieche und allen alles wurde (vgl. 1 Kor 9,22), für die christliche Botschaft eine neue Sprache gewonnen, die ihn fähig machte, seine eigene Botschaft tiefer zu verstehen. In ähnlicher Weise würde sich der Dialog des Christentums mit dem Islam, dem Buddhismus und dem Hinduismus für alle Beteiligten auswirken.
Der Islam versteht sich als die vollständige Ergebung in den Willen Gottes, dessen Einzigkeit und schlechthinnige Absolutheit er anerkennen will. Mohammed ist der Prophet der Absolutheit Gottes.
Als die Mitte des Korans erweist sich die Lehre, daß Gott, der der Schöpfer der Welt ist, uns Menschen Barmherzigkeit erweist; deshalb sollen auch wir Menschen einander Barmherzigkeit erweisen(29).
Im Dialog mit dem Islam müßte sich herausstellen, daß überhaupt nur, wenn es einem um die Anerkennung der Einzigkeit und schlechthinnigen Absolutheit Gottes geht, die Trinitätslehre des Christentums verständlich erläutert werden kann. Sie erweist sich dann als die Bedingung der Möglichkeit, Gottes unendliche Barmherzigkeit für uns auszusagen. Es geht in der Trinitätslehre gerade darum, die Transzendenz und Einzigkeit Gottes zu wahren. Dies geschieht, indem ausgeschlossen wird, daß die Welt der konstitutive Terminus einer Relation Gottes auf sie sein könne.
Der Hinduismus sucht den Menschen aus einem übergreifenden Geheimnis zu verstehen, das er in mythischer Weise aussagt. Seine zentralen Begriffe sind »gamah. « (Überlieferungsautorität jenseits profaner Erkenntnismittel) und »tantram« (Zusammenhang dessen, wodurch Menschen vor Furcht bewahrt werden)(30).
Im Dialog mit dem Hinduismus ergibt sich eine entscheidende Entsprechung der christlichen Botschaft: Der Glaube kommt schlechthin »vom Hören«, durch die Weitergabe des Glaubens in dem mitmenschlichen Wort der Glaubensverkündigung, das selber das »Wort Gottes« ist. Und alle einzelnen Glaubensaussagen sind immer nur als Entfaltungen eines einzigen Grundgeheimnisses verstehbar, nämlich unseres Anteilhabens am Gottesverhältnis Jesu. Nur wenn Glaubensaussagen sich nicht additiv zueinander verhalten, können sie unüberbietbar sein.
Nach dem Buddhismus entgeht der Mensch dem Kreislauf des Leidens durch das Erwachen zur Einsicht in die radikale Leidhaftigkeit des Daseins und das Aufgeben des unbeständigen Ich zugunsten des tieferen Selbst, das erst in der Transzendenzerfahrung des Nirvana zur Ruhe kommt.
Gerade im Gespräch mit dem Buddhismus wird deutlich, daß es auch im christlichen Glauben an Gott letztlich um die Alternative zu jener Begierde geht, die letztlich Weltvergötterung ist. Der Glaube versteht sich als Alternative zu jeder Form von Weltvergötterung und damit auch von Verzweiflung an der Welt, die eintritt, wenn einem das genommen wird, was man fälschlich vergöttert hatte. Wodurch gewinnt der Mensch die Fähigkeit des Loslassens, wenn nicht durch eine letzte Geborgenheit?
Durch das Gespräch mit dem Buddhismus kommt im Christentum auch die sogenannte »negative Theologie« neu zur Geltung, deren Anliegen es ist, durch die Anerkennung der Einseitigkeit der Analogie der Welt Gott gegenüber die Unbegreiflichkeit Gottes radikal zu wahren.
Es gibt sogar im Atheismus eine religiöse Seite. Der Atheismus besteht in der berechtigten Ablehnung der Vorstellung von einem »höchsten Wesen«, das in Konkurrenz zur Eigenständigkeit der Welt träte und damit selber welthaft gedacht wäre. Durch die Auseinandersetzung mit der christlichen Botschaft wird diese Ablehnung offen gehalten für ein anderes Gottesverständnis. Der Wahrheitskern des Atheismus besteht darin, davor zu warnen, Gott und Welt unter das gleiche Wirklichkeitsverständnis zu fassen. Im Gespräch mit dem Atheismus würden auch Christen davor bewahrt, Gott im Widerspruch zum christlichen Glauben als einen Teil der Wirklichkeit zu verstehen anstatt alle Wirklichkeit überhaupt als Gottes Schöpfung.
So kann das Gespräch mit den Religionen und selbst mit dem Atheismus für alle Beteiligten hilfreich sein, um sich auf die Anerkennung eines unüberbietbaren Heils zurückzubesinnen, ohne die keine Religion in Wahrheit Religion ist.